 Beim Schweizer Architektenhaus in Zumikon konnten zwei Bohrungen für die Geothermie bis zu 450 m Tiefe mit einer Bohrlaufzeit von 50 Minuten durchgefüht werden. Es werden also 10 m/Min erreicht, das der Zeit einer geläufigen Doppel-U-Sonde aus Polyethylen (PE) entspricht. Wasser wurde über den Sondenfuß in die Koaxialsonden eingegossen und die Sonden anschließend abgeschlossen. Die Druckprüfung wurde mit einer REHAU-Schiebehülse erfolgreich abgeschlossen.
Beim Schweizer Architektenhaus in Zumikon konnten zwei Bohrungen für die Geothermie bis zu 450 m Tiefe mit einer Bohrlaufzeit von 50 Minuten durchgefüht werden. Es werden also 10 m/Min erreicht, das der Zeit einer geläufigen Doppel-U-Sonde aus Polyethylen (PE) entspricht. Wasser wurde über den Sondenfuß in die Koaxialsonden eingegossen und die Sonden anschließend abgeschlossen. Die Druckprüfung wurde mit einer REHAU-Schiebehülse erfolgreich abgeschlossen.
Neben der Wirtschaftlichkeit wurden durch den Einsatz folgender Faktoren die Voraussetzungen für die Reduzierung des CO2-Ausstoß auf Weiterlesen →
Letztes Update: 2016.01.19
Hohe Effizienz aus Geothermie

Dipl.-Ing. Kristin Graichen
Im Kern hat die Erde eine Temperatur bis zu 3000°C. Ganz so tief braucht man nicht zu bohren, um Erdwärme energetisch nutzbar zu machen. Denn Erdwärme muss nicht zwingend aus der Tiefe kommen.
In Köln-Niehl reichten schon 25 Meter für ein geothermisches Modellprojekt, da die oberflächennahe Energie hier durch die Sonneneinstrahlung gespeist wird: Kölns dominierende Wohnungsgesellschaft, die GAG Immobilien AG, baut auf dem ehemaligen Siemensgelände derzeit die größte Wärmepumpensiedlung Europas mit 404 Wohneinheiten.
Weiterlesen →
Letztes Update: 2013.04.02
Frostschutz und Korrosionsschutz

Dr. Achim Stankowiak
Die oberflächennahe Geothermie (Erdwärme) hat speziell in den letzten Jahren einen deutlichen Aufschwung erfahren. Obwohl in der Gesamtinvestition nur von absolut untergeordneter Bedeutung, ist die Wahl der richtigen Wärmeträgerflüssigkeit für einen langjährigen, reibungslosen und wartungsarmen Betrieb von enormer Bedeutung.
Für einen effizienten und sicheren Gebrauch einer oberflächennahen Geothermie-Anlage sollte ein Wärmeträgerfluid eingesetzt werden, das sowohl Frostschutz als auch einen zuverlässigen Korrosionsschutz bietet. Im Folgenden werden die Anforderungen an eine moderne Geothermie-Wärmeträgerflüssigkeit beschrieben.
Weiterlesen →
Letztes Update: 2013.04.02
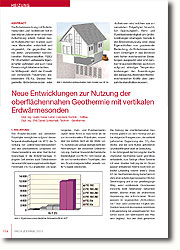
Dipl.-Ing. Guido Kania, Dipl.-Ing. (FH) Daniel Gottschalk
Die Erdwärmenutzung mit Erdwärmesonden und -kollektoren hat in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erlebt. Neben neuen Kollektorformen wurden auch neue Materialien entwickelt und eingesetzt, die gegenüber den bis dahin verwendeten konventionellen Rohrwerkstoffen PE80/PE100 erheblich verbesserte Eigenschaften aufweisen und auch neue Einsatzmöglichkeiten erlauben. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von vernetztem Polyethylen, insbesondere PE-Xa. Daraus hergestellte Erdwärmesonden oder -kollektoren sind solchen aus unvernetztem Polyethylen hinsichtlich Spannungsriß-, Kerb- und Punktlastbeständigkeit um Größenordnungen überlegen. Gerade in der Erdwärmenutzung sind diese Eigenschaften von gravierender Bedeutung, da Erdwärmesonden beim Einbringen in das Bohrloch sehr hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind und darüber hinaus beim Betrieb auch noch aufgrund ständiger Temperaturänderungen den Auswirkungen der daraus resultierenden thermomechanischen Kräfte über Jahrzehnte
Weiterlesen →
Letztes Update: 2013.04.02
 Beim Schweizer Architektenhaus in Zumikon konnten zwei Bohrungen für die Geothermie bis zu 450 m Tiefe mit einer Bohrlaufzeit von 50 Minuten durchgefüht werden. Es werden also 10 m/Min erreicht, das der Zeit einer geläufigen Doppel-U-Sonde aus Polyethylen (PE) entspricht. Wasser wurde über den Sondenfuß in die Koaxialsonden eingegossen und die Sonden anschließend abgeschlossen. Die Druckprüfung wurde mit einer REHAU-Schiebehülse erfolgreich abgeschlossen.
Beim Schweizer Architektenhaus in Zumikon konnten zwei Bohrungen für die Geothermie bis zu 450 m Tiefe mit einer Bohrlaufzeit von 50 Minuten durchgefüht werden. Es werden also 10 m/Min erreicht, das der Zeit einer geläufigen Doppel-U-Sonde aus Polyethylen (PE) entspricht. Wasser wurde über den Sondenfuß in die Koaxialsonden eingegossen und die Sonden anschließend abgeschlossen. Die Druckprüfung wurde mit einer REHAU-Schiebehülse erfolgreich abgeschlossen.
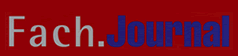


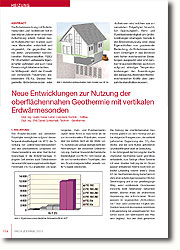
 Mit RSS-Feed - keine neuen Artikel verpassen
Mit RSS-Feed - keine neuen Artikel verpassen